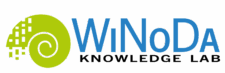Am 20. November 2024 fand die zweite Veranstaltung der Reihe „Quo Vadis Open Science in Berlin und Brandenburg 2024/25“ mit dem Titel „Objektbezogenes Open Access – Open Access für Objekte“ statt. Unter der Moderation von Sophie Kobialka vom Datenkompetenzzentrum WiNoDa waren die Herausforderungen und blinden Flecken im Zusammenhang mit Open Access (OA) für Objekte und andere nicht-textuelle Inhalte Thema. Auf dem Podium diskutierten Friederike Kramer (Universitätsbibliothek der Universität der Künste), Melanie Seltmann (Datenkompetenzzentrum QUADRIGA) und Ben Kaden (Vernetzungs- und Kompetenzzentrum für Open Access in Brandenburg / WiNoDa).
Heterogenität nicht-textueller Materialien
Zum Einstieg waren die Teilnehmenden sich einig über die große Heterogenität von nicht-textuellen Materialien wie Objekten und dem bewegten Bild. Diese Vielfalt führt oft zu Mehrdeutigkeit in ihrer Klassifizierung und ihren Nutzungskontexten sowie zu unterschiedlichen Perspektiven auf Offenheit. Friederike Kramer betonte die fließenden Übergänge in der Kunst, wo die Beschäftigung mit Objekten künstlerische und wissenschaftliche Bereiche, Forschung und Lehre umfassen kann, sowie die Unterscheidung zwischen Objekten, Daten allgemein und Forschungsdaten. Da Objekte in verschiedenen Stadien in Forschungsdaten übergehen können, ist es wichtig, den gesamten Lebenszyklus der Daten zu berücksichtigen und sich nicht nur auf den traditionellen akademischen Forschungsrahmen zu konzentrieren.

Die vielschichtige Natur von Objekten
Ben Kaden führte diese Heterogenität aus der Perspektive von WiNoDa weiter aus und stellte fest, dass jedes Objekt innerhalb einer Sammlung das Potenzial hat, als Forschungsobjekt zu dienen, selbst wenn es ursprünglich nicht zu diesem Zweck geschaffen wurde. Museumsobjekte sind von Natur aus vielschichtig und erfüllen verschiedene Funktionen, einschließlich der Präsentation in einem Ausstellungskontext. Melanie Seltmann wies auf die Komplexität des bewegten Bildes hin – einem der Schwerpunkte von QUADRIGA. Dabei ist die Erstellung von Korpora und Annotationen oft mit Textarbeit verbunden, die das nicht-textuelle Material ergänzt. Für eine effektive Wiederverwendung ist es wichtig, nicht nur den freien Zugang zu diesen Texten, sondern auch zu den digitalen Objekten selbst zu gewährleisten. Die Urheberrechtsbestimmungen für Filme können diesen Prozess jedoch erschweren und die Möglichkeiten der Wiederverwendung erheblich einschränken.
Open Access Monitoring
Das Podium kam zu dem Schluss, dass sich das Monitoring von Open Access für Objekte und nicht-textuelle Inhalte nur in bestimmten Kontexten als nützlich erweist. Zugriffs- und Nutzungsstatistiken können Autoren zwar motivieren, erfassen aber oft nicht die qualitativen Aspekte des Engagements. Ein enger Fokus auf Statistiken kann Fehlanreize schaffen und eine angemessene Bewertung der Aktivitäten von Forschenden behindern. Ein interessanter Ansatz für das Monitoring könnte die Verwendung von Metadaten zu Nutzungs- und Objektbiografien sein, die die Provenienz und die kontinuierliche Wiederverwendung dokumentieren. Solche Metadaten könnten in wertvolle Forschungsdaten umgewandelt werden, die zu einem tieferen Verständnis der Objekthistorie beitragen.
Herausforderungen für die Infrastruktur
Infrastrukturen, die Open Access für nicht-textuelle Inhalte unterstützen, stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie Open Access allgemein. Selbst gut konzipierte Plattformen werden selten in großem Umfang genutzt, weil die Forschenden die bibliotheksgestützten Arbeitsabläufe als ungewohnt empfinden. Um dieses Problem zu lösen, könnten intuitivere Dateneingabestrukturen entwickelt und Schulungsmöglichkeiten geschaffen werden, die die notwendigen Kompetenzen vermitteln. Forschende, die nicht-textuelle Inhalte veröffentlichen, bevorzugen oft Plattformen, die in ihrer eigenen Gemeinschaft bekannt sind – insbesondere solche, die Forschung mit künstlerischen oder kommunikativen Praktiken verbinden -, was dazu führt, dass bibliothekarische Dienste nicht ausreichend genutzt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Wert dieser Bibliotheksdienste zu vermitteln und gleichzeitig offen dafür zu bleiben, warum Forschende alternative Plattformen bevorzugen.
Notwendige Kompetenzen
Die Diskussion unterstrich die Notwendigkeit einer Reihe grundlegender Kompetenzen, um sich in den verschiedenen Plattformtypen zurechtzufinden, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu kennen und Plattformen nach Publikationszielen auszuwählen – sei es für die Präsentation oder die Nachnutzung. Autor*innen und Forschenden sollten wissen, welche Plattformen Open Access ermöglichen, die relevanten technischen Standards (wie Persistent Identifiers und Langzeitarchivierung) verstehen und wissen, wie offene Lizenzen wie Creative Commons die Nachnutzung ermöglichen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Open Access für nicht-textuelle Inhalte zwar kein neues Thema ist, diese Diskussion aber gezeigt hat, dass die besonderen Anforderungen, die durch heterogene Daten und Objekte entstehen, noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Erkenntnisse aus der Open-Access-Praxis im Zusammenhang mit formalen Publikationen wie Zeitschriftenartikeln oder Monographien bieten wertvolle Ansatzpunkte, lassen sich aber ohne Anpassung an die besonderen Anforderungen nicht-textueller Inhalte nicht unmittelbar anwenden. Zu den wichtigsten Unterschieden gehören die medienspezifischen Merkmale digitaler Objekte, der fließende Übergang zwischen verschiedenen Datenzuständen während des gesamten Datenzyklus’ und die Beteiligung von Urheber*innen, die wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Tätigkeiten zusammenbringen – all dies bringt praktische und rechtliche Herausforderungen mit sich. Um diese Probleme wirksam anzugehen, ist eine weitere Erörterung dieser Aspekte unter Einbeziehung rechtlicher Fragen unerlässlich.
Gekürzt von Philipp Kandler: Open Access zu nicht textuellen Inhalten. Kurzbericht zur Quo Vadis-Veranstaltung vom 20.11.2024. 4.12.2024. https://open-access-brandenburg.de/open-access-zu-nicht-textuellen-inhalten/
Weitere Informationen zur Veranstaltung:
https://open-access-brandenburg.de/events/objektbezogenes-open-access-open-access-fuer-objekte-quo-vadis-offene-wissenschaft/
https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/2024/10/21/quo-vadis-4-objektbezogenes-open-access-open-access-fuer-objekte-20-november-2024/